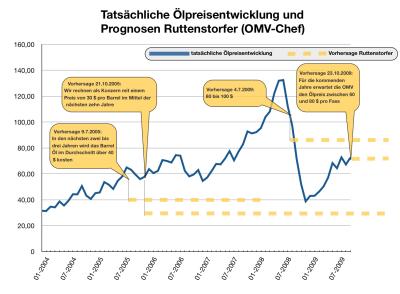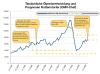Wo Wien Kopenhagen schlägt
von cc am 09.12.2009
meine dieswöchige falter - Mobilitätskolumne:
“Copenhagenize your city”, so lautet rund um den Klimagipfel ein Schlachtruf, der völlig zurecht die dänische Hauptstadt als Vorbild preist.
36 % aller Wege werden dort mit dem Fahrrad zurückgelegt, mehr als mit dem Auto, und die Stadt hat ehrgeizige Pläne vorgelegt, diesen Wert noch zu steigern.
“Copenhagenize” rückt zurecht städtische Verkehrspolitik ins Zentrum. Weltweit lebt bereits die Hälfte der Menschheit in Städten; deren Verkehrsverhalten wird maßgeblich darüber entscheiden, ob die große Energie- und Klimawende, die alle beschwören, gelingen kann.
36% Radverkehr in einer Großstadt sind ein beachtlicher Wert. München ist auch nicht schlecht, und weist 15 % auf, Wien`s 6% sind schlicht erbärmlich.
Und doch gibt es da in Wien etwas, das Kopenhagen weit hinter sich läßt.
“Es” feiert dieser Tage seinen zehnten Geburtstag.
“Es” wird jährlich von Gästen und Neugierigen aus allen Teilen der Welt besucht, die wissen wollen, wie “soetwas” möglich ist.
Das offizielle Wien jedoch wird auch diesen runden Geburtstag kaum zu würdigen wissen.
Denn “es” zeigt, daß eine völlig andere Verkehrs-und Stadtplanungspolitik möglich wäre.
“Es” heißt autofreie Siedlung, und der Ordnung halber füge ich hinzu, daß ich den objektiver Berichterstatter schwerlich mimen kann, war ich nicht nur maßgeblich an der Durchsetzung dieses Experiments beteiligt, sondern ebenso im permanenten Bemühen bin, dieses kleine, schlicht unglaubliche Stück “Stadt der Zukunft” in die große Breite zu führen.
Aber auch ein Liebhaber darf ein Lied singen.
Die Fakten sind kurz erzählt.
Autofreiheit heißt hier in Floridsdorf: Statt 250 Wohnungen mit 250 teuren Tiefgaragenplätzen auszustatten wurden 90% einfach nicht gebaut.
Die Odyssee zu schildern, solches im Wiener Garagengesetz zu ermöglichen, ergäbe ein Buch.
Das dadurch freiwerdende Geld, weit mehr als 1 Mio Euro wurde in großzügige Freiräume, allgemein zugängliche Dachgärten, eine Sauna, ein Kinderhaus, eine Radwerkstätte, ein Fitnesscenter, einen Veranstaltungssaal, Mietergärten und viele andere Gemeinschaftseinrichtungen investiert.
Im Gegenzug verpflichteten sich die Mieter vertraglich, kein eigenes Auto zu besitzen, sondern das Rad und den öffentlichen Verkehr, sowie car-sharing Angebote zu nutzen.
Schon vor Baubeginn wurde ein umfassender Mitbestimmungsprozeß initiiert.
Es bildeten sich eine Reihe von Gruppen, welche die Verantwortung über die unterschiedlichen Gemeinschaftseinrichtungen übernahmen.
Das ließ eine ganz spezifische Kultur in der “autofreien” entstehen: eine intensive Nachbarschaft, welche insbesondere Kinder zu nutzen und zu geniessen wußten.
Denn Kinder wollen vor allem eins: andere Kinder. Sie brauchen Platz, um zu sich selbstbestimmt und sicher zu bewegen. Beides ist in der “autofreien” reichlich vorhanden.
So hat die wahrscheinlich interessanteste Bilanz dieses Pilotprojektes weniger mit dem Auto zu tun, als mit der Tatsache, daß dort deutlich mehr Kinder geboren wurden als in vergleichbaren Siedlungen, wo mehr oder wenig isolierte Kleinfamilien schon mit ein oder zwei Kindern ziemlich überfordert sind.
Eine kinderfreundliche Nachbarschaft entlastet enorm.
Einigen der gewachsenen Familien wurden jedoch ihre Wohnung zu klein.
Wie gut, daß in der unmittelbarer Nähe weitere Wohnhäuser geplant wurden. Eine initiative “Miss Autofrei” bemühte sich sehr darum, das offensichtlich erfolgreiche Modell auch dort anzuwenden.
Aber v.a. vom Bezirk gab es ein heftiges Veto. “Soetwas” komme nicht nocheinmal.
Denn “soetwas” funktionierte nun mal nicht.
Denn obwohl erst jüngst eine von der Stadt selbst beauftragte Studie eindeutig ergab, daß die überwältigende Mehrheit der Bewohner in der “autofreien” tatsächlich auch heute noch kein Auto besitzen, darf “das” einfach nicht sein.
Wie brachte dieses Bewußtsein vor gut zehn Jahren ein inzwischen pensionierter Beamter auf den Punkt: Bei einer Diskussion über die Besiedelungsmodalitäten kam der Vergleich zum damals so genannten “frauengerechten Wohnen” auf.
Seine Replik werde ich nie vergessen: “Eine Siedlung ohne Männer kann ich mir ja vorstellen, aber mit Sicherheit keine ohne Autos”.
Copenhagenize Vienna!
Noch einmal, weils so schön ist: Radanteil Kopenhagen 36%.Wien 6%. Autofreie Siedlung: 56%
“Copenhagenize your city”, so lautet rund um den Klimagipfel ein Schlachtruf, der völlig zurecht die dänische Hauptstadt als Vorbild preist.
36 % aller Wege werden dort mit dem Fahrrad zurückgelegt, mehr als mit dem Auto, und die Stadt hat ehrgeizige Pläne vorgelegt, diesen Wert noch zu steigern.
“Copenhagenize” rückt zurecht städtische Verkehrspolitik ins Zentrum. Weltweit lebt bereits die Hälfte der Menschheit in Städten; deren Verkehrsverhalten wird maßgeblich darüber entscheiden, ob die große Energie- und Klimawende, die alle beschwören, gelingen kann.
36% Radverkehr in einer Großstadt sind ein beachtlicher Wert. München ist auch nicht schlecht, und weist 15 % auf, Wien`s 6% sind schlicht erbärmlich.
Und doch gibt es da in Wien etwas, das Kopenhagen weit hinter sich läßt.
“Es” feiert dieser Tage seinen zehnten Geburtstag.
“Es” wird jährlich von Gästen und Neugierigen aus allen Teilen der Welt besucht, die wissen wollen, wie “soetwas” möglich ist.
Das offizielle Wien jedoch wird auch diesen runden Geburtstag kaum zu würdigen wissen.
Denn “es” zeigt, daß eine völlig andere Verkehrs-und Stadtplanungspolitik möglich wäre.
“Es” heißt autofreie Siedlung, und der Ordnung halber füge ich hinzu, daß ich den objektiver Berichterstatter schwerlich mimen kann, war ich nicht nur maßgeblich an der Durchsetzung dieses Experiments beteiligt, sondern ebenso im permanenten Bemühen bin, dieses kleine, schlicht unglaubliche Stück “Stadt der Zukunft” in die große Breite zu führen.
Aber auch ein Liebhaber darf ein Lied singen.
Die Fakten sind kurz erzählt.
Autofreiheit heißt hier in Floridsdorf: Statt 250 Wohnungen mit 250 teuren Tiefgaragenplätzen auszustatten wurden 90% einfach nicht gebaut.
Die Odyssee zu schildern, solches im Wiener Garagengesetz zu ermöglichen, ergäbe ein Buch.
Das dadurch freiwerdende Geld, weit mehr als 1 Mio Euro wurde in großzügige Freiräume, allgemein zugängliche Dachgärten, eine Sauna, ein Kinderhaus, eine Radwerkstätte, ein Fitnesscenter, einen Veranstaltungssaal, Mietergärten und viele andere Gemeinschaftseinrichtungen investiert.
Im Gegenzug verpflichteten sich die Mieter vertraglich, kein eigenes Auto zu besitzen, sondern das Rad und den öffentlichen Verkehr, sowie car-sharing Angebote zu nutzen.
Schon vor Baubeginn wurde ein umfassender Mitbestimmungsprozeß initiiert.
Es bildeten sich eine Reihe von Gruppen, welche die Verantwortung über die unterschiedlichen Gemeinschaftseinrichtungen übernahmen.
Das ließ eine ganz spezifische Kultur in der “autofreien” entstehen: eine intensive Nachbarschaft, welche insbesondere Kinder zu nutzen und zu geniessen wußten.
Denn Kinder wollen vor allem eins: andere Kinder. Sie brauchen Platz, um zu sich selbstbestimmt und sicher zu bewegen. Beides ist in der “autofreien” reichlich vorhanden.
So hat die wahrscheinlich interessanteste Bilanz dieses Pilotprojektes weniger mit dem Auto zu tun, als mit der Tatsache, daß dort deutlich mehr Kinder geboren wurden als in vergleichbaren Siedlungen, wo mehr oder wenig isolierte Kleinfamilien schon mit ein oder zwei Kindern ziemlich überfordert sind.
Eine kinderfreundliche Nachbarschaft entlastet enorm.
Einigen der gewachsenen Familien wurden jedoch ihre Wohnung zu klein.
Wie gut, daß in der unmittelbarer Nähe weitere Wohnhäuser geplant wurden. Eine initiative “Miss Autofrei” bemühte sich sehr darum, das offensichtlich erfolgreiche Modell auch dort anzuwenden.
Aber v.a. vom Bezirk gab es ein heftiges Veto. “Soetwas” komme nicht nocheinmal.
Denn “soetwas” funktionierte nun mal nicht.
Denn obwohl erst jüngst eine von der Stadt selbst beauftragte Studie eindeutig ergab, daß die überwältigende Mehrheit der Bewohner in der “autofreien” tatsächlich auch heute noch kein Auto besitzen, darf “das” einfach nicht sein.
Wie brachte dieses Bewußtsein vor gut zehn Jahren ein inzwischen pensionierter Beamter auf den Punkt: Bei einer Diskussion über die Besiedelungsmodalitäten kam der Vergleich zum damals so genannten “frauengerechten Wohnen” auf.
Seine Replik werde ich nie vergessen: “Eine Siedlung ohne Männer kann ich mir ja vorstellen, aber mit Sicherheit keine ohne Autos”.
Copenhagenize Vienna!
Noch einmal, weils so schön ist: Radanteil Kopenhagen 36%.Wien 6%. Autofreie Siedlung: 56%